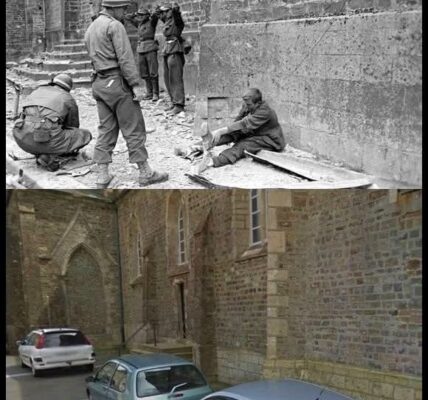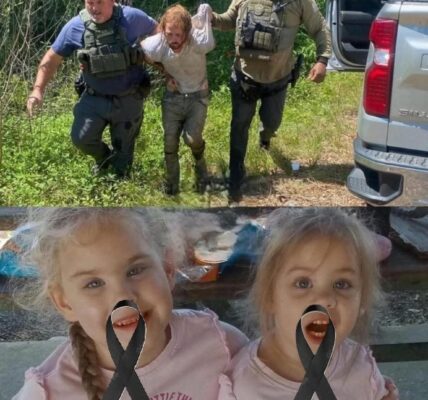Am 27. April 1942 traf der erste Transport von 127 polnischen Frauen aus den Gefängnissen in Krakau und Tarnów in Auschwitz ein. Unter ihnen war Helena Panek (geb. 1922, Nr. 6892), die sich an den Moment des Transports wie folgt erinnerte:
„Am 27. April, gegen 3 Uhr morgens, wurden etwa sechzig weibliche Gefangene aus dem Gefängnis in Tarnów geführt, und wir wurden unter starker Gendarmenbewachung zum Bahnhof gebracht, wo man uns in einen Gefangenentransportwagen trieb. Dieser wurde später an einen anderen Zug angekoppelt. Gegen neun Uhr, eskortiert von Gendarmen, fuhren wir ins Ungewisse. Die Aufseher fragten uns wiederholt, wohin wir unterwegs seien, doch wir schwiegen.
Gegen Mittag erreichten wir Krakau, und irgendwo auf einem Nebengleis hielt der Zug an und wartete darauf, an einen anderen Zug angekoppelt zu werden. Schließlich fuhren wir weiter, jedoch nicht lange, denn wieder hielten wir an. Es stellte sich heraus, dass wir an der Grenze zwischen dem Generalgouvernement und dem Reich angekommen waren. Wieder hielten wir an einem großen Bahnhof. Durch ein vergittertes Fenster konnten wir den Namen der Stadt auf dem Bahnhofsgebäude lesen: Auschwitz. Wir wussten bereits, dass es Oświęcim ist.
Wir wurden auf ein Abstellgleis gebracht. Es war uns nicht erlaubt, uns dem Fenster zu nähern. Schließlich hielt der Zug an. Es war sechs Uhr abends.
Von draußen hörten wir wilde Schreie. Die Tür unseres Wagens öffnete sich. Jemand draußen rief auf Deutsch: Alle raus! – Beeilt euch, ihr verdammten Banditen! Die Wachen schlugen uns mit Gewehrkolben auf den Rücken. Wir drängten uns gemeinsam zu einem Ausgang. Das Geschrei ließ unsere Köpfe schwirren. Eine nach der anderen sprangen wir aus dem Waggon direkt in die kreischenden SS-Frauen und SS-Männer, die sich in einer Reihe um den Waggon aufgestellt hatten. Zwischen dem Gebrüll der Deutschen und dem Bellen abgerichteter Schäferhunde wurden wir in eine Reihe gestellt und ins Lager geführt.
Nachdem wir durch ein Tor gegangen waren, hielten sie uns vor einem Gebäude an, zählten mehrmals, und nach einem kurzen Halt führten sie uns in Reihen in ein Badehaus, wo eiskaltes Wasser auf uns wartete. Dort wurden uns unsere Sachen und unsere Kleidung abgenommen. Nach dem Bad erhielten wir gestreifte Sommeruniformen. Und schmutzige, graue Unterwäsche. An unseren Füßen trugen wir niederländische Holzpantinen, mehrere Größen zu groß. Uns wurden auch Nummern auf einem weißen Stück Stoff gegeben, die an das Kleid genäht werden mussten.
Spät am Abend wurden wir in Block 8 geführt, in einen sehr großen Saal, in dem Matratzen mit irgendeiner Spreu oder Stroh auf dem Boden lagen. Jede erhielt eine dünne Decke. Am nächsten Tag, bereits in unserer Lagerkleidung, erkannten wir uns gegenseitig nicht mehr.
Beim ersten Appell fragten die Deutschen, wer Deutsch sprechen könne. Beim Appell beobachteten wir junge weibliche Häftlinge, die früher ins Lager gebracht worden waren. Wie sich herausstellte, waren es jüdische Frauen aus der Slowakei. Sie waren seltsam gekleidet, denn sie trugen Uniformen von Kriegsgefangenen, hatten geschorene Köpfe und waren sehr mager. Ihr Anblick erschütterte uns, und für viele war das ein Grund für einen Nervenzusammenbruch.
Erschrocken über diesen Anblick sprachen wir mit Marysia Fleckowa und Stefcia Łącka darüber, was uns erwartete, wie lange wir unter solchen Bedingungen leben könnten und warum uns solches Unrecht widerfahren war.
Nach dem Morgenappell wurden wir ins Männerlager gebracht, um fotografiert zu werden. Die Fotografien der Gefangenen wurden im Fotostudio des Lager-Gestapo-Erkennungsdienstes gemacht, das sich in Block 26 befand. Wir wurden nicht sofort tätowiert. Unsere Nummern waren auf unsere gestreiften Uniformen genäht.
Am dritten Tag begann der Lageralltag: Aufstehen im Morgengrauen, Appell, dann Arbeit über unsere Kräfte hinaus, verbunden mit Schlägen und Misshandlungen.“
Helena Panek überlebte den Krieg. Sie verstarb im Jahr 2020